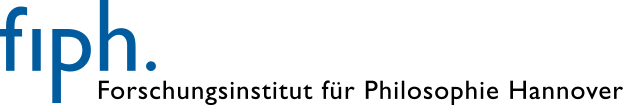Fellow von Oktober 2016 bis September 2018
Burkhard Liebsch, Prof. Dr., nach dem Studium der Philosophie, Psychologie, Sozialwissenschaften und Pädagogik in Heidelberg und Bochum, Lehr- und Forschungstätigkeit seit 1989 an universitären und außeruniversitären Instituten in Bochum, Ulm, Essen (KWI), Hannover (FIPH), Leipzig; Gastdozent u.a. an den Universitäten von Sofia, Debrecen, Bukarest, Belgrad, Bamberg und Vilnius; lehrt apl. Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum; Arbeitsschwerpunkte: Praktische Philosophie/Sozialphilosophie; Theorie der Geschichte; Das Politische in kulturwissenschaftlicher Perspektive; spezielle Forschungsthemen: Gewaltforschung, Kulturtheorie, Lebensformen, Sensibilität, Erinnerungspolitik, Europäisierung, Erfahrungen der Negativität, Geschichte des menschlichen Selbst. Neuere Veröffentlichungen: Gastlichkeit und Freiheit (2005); Revisionen der Trauer (2006); Subtile Gewalt (2007); Gegebenes Wort oder Gelebtes Versprechen (2008); Für eine Kultur der Gastlichkeit (2008); Menschliche Sensibilität (2008); Renaissance des Menschen? (2010); Prekäre Selbst-Bezeugung. Die erschütterte Wer-Frage im Horizont der Moderne (2012); Verletztes Leben (2014); Unaufhebbare Gewalt. Umrisse einer Anti-Geschichte des Politischen. Leipziger Vorlesungen zur Politischen Theorie und Sozialphilosophie (2015); In der Zwischenzeit. Spielräume menschlicher Generativität (2016); Zeit-Gewalt und Gewalt-Zeit. Dimensionen verfehlter Gegenwart in phänomenologischen, politischen und historischen Perspektiven (2017). (Mit-) Hrsg. u. a. von: Handbuch der Kulturwissenschaften (2004/22011); Hegel und Levinas (2010); Bezeugte Vergangenheit oder Versöhnendes Vergessen. Geschichtstheorie nach P. Ricœur (2010); Profile negativistischer Sozialphilosophie. Ein Kompendium (2011); Bedingungslos? Zum Gewaltpotenzial unbedingter Ansprüche im Kontext politischer Theorie(2014); Perspektiven europäischer Gastlichkeit. Geschichte ‒ Kulturelle Praktiken ‒ Kritik (2016); im Erscheinen: Der Andere in der Geschichte. Sozialphilosophie im Zeichen des Krieges (2016); Der Andere in der Geschichte. Sozialphilosophie im Zeichen des Krieges. Ein kooperativer Kommentar zu Emmanuel Levinas’ Totalität und Unendlichkeit (2016/22017).
Zur Homepage von Burkhard Liebsch
Projekt am fiph
‚Einander ausgesetzt’. Umrisse einer Topografie des Sozialen
‚Sozial’ leben wir nur dank Anderer, in Beziehungen, Verhältnissen, Kontexten und Systemen, die das in ihrer Normalität weitgehend in Vergessenheit fallen lassen können. Dann fragt man sich, ob man Anderer überhaupt bedarf, ob man auf sie angewiesen ist oder auch ganz ohne sie auskommen kann ‒ sei es in Formen weltflüchtigen oder einsamen Daseins, sei es in einem Wohlstand, der sie sich weitestgehend vom Leib hält. Alle Formen dieser oder jener Distanznahme setzen aber eine vorgängige Veranderung des eigenen Selbst bereits voraus, die es Anderen aussetzt und von Geburt an auf sie angewiesen sein lässt. Die in diesem hochambivalenten Ausgesetzt- und Angewiesensein liegenden Herausforderungen sind politisch anzunehmen ‒ auch um den Preis verschärfter Furcht, der Angst und des Misstrauens in Zeiten der Gewalt, die politische Lebensformen von außen und von innen gefährden und zu ruinieren drohen. Auf bestimmte politische Lebensformen ist normalerweise jeder angewiesen ‒ erst recht aber unter Bedingungen, die zu grenzüberschreitender Migration und Flucht zwingen können und dann die Frage aufwerfen, wie wir uns zu unserem Ausgesetztsein verhalten können, ohne es zu verharmlosen, ohne es zu leugnen und ohne sich zurückzuziehen in eine Defensive und Isolation, die die entscheidende politische Qualität sozialer Lebensformen unterminieren muss: ihre so viel gelobte Offenheit. Das skizzierte Projekt entwirft eine Theorie des Sozialen, die vom ersten Ausgesetztsein über Furcht und Hass diese Offenheit neu zu denken versucht. So soll sich eine Topografie des Sozialen abzeichnen, die sich vor allem an den existenziellen und politischen Gefahren orientiert, denen es ausgesetzt ist. Diese Gefahren markieren gewissermaßen das Profil des politischen Geländes, in dem sich soziales Leben heute bewegt. In diesem Sinne dient das Projekt dem „Erfassen des Gegenwärtigen und Wirklichen“ (Hegel), ohne das es ein „Ergründen des Vernünftigen“ nicht geben kann.