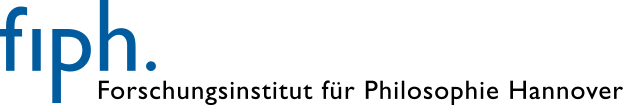Fellow von September 2025 bis August 2027
Zur Person
Dr. Carlotta Voß hat an der Freien Universität Berlin Geschichte, Politikwissenschaft und Theologie studiert und 2021 nach Forschungsaufenthalten an der University of Oxford an der Ruhr-Universität Bochum mit einer Arbeit unter dem Titel „Ironie und Urteil. Ironische Historiographie und die Entdeckung des Politischen bei Thukydides“ promoviert. Nach der Promotion war sie auf Einladung von Prof. Rainer Forst Postdoc-Fellow am Justitia Center for Advanced Studies an der Goethe Universität Frankfurt.
Ihre Forschung kreist um das Verhältnis von politischen Handlungsmodellen und Konzeptionen gelingenden Lebens. Systematisch gesprochen gelten ihre Interessen der (republikanischen) Demokratietheorie, der Philosophischen Anthropologie, der Lebensphilosophie, der Politischen Theologie, der Tugendethik, und Begriffen des „Tragischen“ wie des „Ironischen“. Ihre ideengeschichtlichen Bezugspunkte liegen in der antiken Politischen Theorie (insb. Thukydides, Aristoteles, Augustinus) und in der Philosophie und Soziologie des frühen 20. Jahrhunderts (insb. Helmuth Plessner, Hannah Arendt, Karl Mannheim, Leo Strauss).
Carlotta Voß lebt und arbeitet als Politische Referentin und Publizistin in Berlin. Sie ist Redakteurin des Online-Magazins „Politik&Ökonomie“.
Das Projekt am FIPH
Postliberalismus und Politiken gelingenden Lebens.
Mit dem Postliberalismus formiert sich eine weltanschauliche Herausforderung des politischen Liberalismus, die in den USA und in Europa elektoral erfolgreiche politische Bewegungen trägt. Ihr zentral ist eine grundlegende Neubestimmung der Sphären von Politik, Ethik und Religion und des Verhältnisses von Person, Gemeinschaft und Gesellschaft. Diskurse gelingenden Lebens, in denen naturalistische und theologische Argumentationen zusammenlaufen, sind ein zentraler Ort dieser Neubestimmung. Mein Forschungsprojekt steht auf zwei Säulen:
Zum einen umfasst es eine wissenssoziologische Analyse des Postliberalismus als Ideologie. Zu diesem Zweck frage ich: Was sind Räume und Methoden postliberaler Wissensproduktion? An welche ideengeschichtlichen Traditionslinien knüpft der Postliberalismus an und wie entwickelt er sie weiter? Welche Begriffe von Vernunft, von Politik und von Geschichte charakterisieren postliberales Denken? Die Analyse verbindet sich mit dem doppelten Ziel, zu einem operationalen Begriff des „Postliberalismus“ als Ideologie zu gelangen, und den Postliberalismus als zugleich Treiber und Symptom einer Krise der transatlantischen liberalen Demokratien zu greifen.
In der Reaktion auf die Krisendiagnostik umfasst mein Projekt zum zweiten den Versuch, mit den Mitteln der Philosophischen Anthropologie einerseits Methode und Grundlage für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Postliberalismus zu gewinnen und andererseits liberale Demokratie als normative Lebensform zu bestimmen, aus der heraus sich Krisenerscheinungen der Gegenwart bewältigen lassen.
Zu diesem Zweck bringe ich zwei Theoretiker Philosophischer Anthropologie in den Dialog: Helmuth Plessner und Wilhlem Kamlah. Beide betreiben Philosophische Anthropologie ausgehend von der These, dass die moderne Philosophie nicht mehr sprechfähig ist im Hinblick auf die Frage nach dem gelingenden Leben, dass sie dazu aber sprechfähig sein muss um die moderne Errungenschaft der „Menschenwürde“ als Fluchtpunkt von Politik- und Gesellschaftsgestaltung zu verteidigen gegen ihre Infragestellung durch naturalistische Anthropologien und vitalistische Ideologien einerseits und historistische Relativierung andererseits.
Plessner gelangt über einen biophilosophischen Ansatz zu einer Neubegründung der Würde als „sozialer Verkörperungsaufgabe“ und zu einer heroischen Verhaltenslehre der „offenen Gesellschaft“, die der Würde des Menschen in diesem Sinne dient und auf die Vermeidung von Demütigung abgestellt ist. Kamlah gelangt über einen sprachphilosophischen Ansatz zu einer normativen und einer eudämonistischen Ethik, die jeweils aufeinander verwiesen sind: Die Grundnorm: „Beachte, dass der Andere ein bedürftiger Mensch ist wie Du und handle demgemäß!“ steht im Fundierungsverhältnis zum Gebot der Gelöstheit.