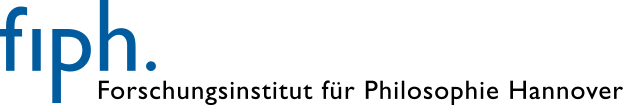Fellow von Oktober 2025 bis Oktober 2026
Zur Person
Seit 2022 promoviere ich in der Nachwuchsforschungsgruppe Democratic Hope an der Freien Universität Berlin. Zuvor habe ich Philosophie und Politikwissenschaft in Berlin und Heidelberg studiert sowie einen Master in German Studies an der Princeton University abgeschlossen. In meinem Dissertationsprojekt untersuche ich, wie in der materialistisch-dialektischen Tradition – von Marx über die frühe Kritische Theorie bis hin zu rassismuskritischen Debatten – Hoffnung als zukunftsgerichtete, erkenntniskritische, aber auch antiutopische Haltung verstanden werden kann, die gesellschaftliche Veränderung ermöglicht, ohne in Spekulation oder Resignation zu verfallen. Darüber hinaus bilden Formen materialistischer Gesellschaftstheorie, Politische Theorie, Sozialphilosophie und die (Ideen)Geschichte des Frankfurter Instituts für Sozialforschung und der frühen Kritischen Theorie meine Forschungsinteressen.
Das Projekt am FIPH
Materialistische Gesellschaftskritik als Politische Theorie der Hoffnung
Die gegenwärtige ethische und gesellschaftliche Herausforderung, über Ungerechtigkeiten und Ungleichheitsverhältnisse innerhalb kapitalistischer Vergesellschaftung nachzudenken – und mögliche Wege hinaus zu finden –, steht im Mittelpunkt meines Projektes, das in der materialistisch-dialektischen Sozialphilosophie verortet ist. Für diese Traditionslinie liegt Emanzipation oder Befreiung weder in der Gegenwart noch in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Dennoch sprach Marx von der Unmöglichkeit, heute die „Rezepte für die Garküche der Zukunft“ zu verschreiben. Seine Kritik an den frühsozialistischen Utopisten verweist auf eine Distanz zum utopischen Denken, die Adorno und Horkheimer später im Begriff des „Bilderverbots“ verdichteten, der seitdem Anlass für Diskussionen über Pessimismus und Antiutopismus innerhalb der marxistischen Theorie gegeben hat.
Ich argumentiere ich meinem Projekt dafür, dass dieser Antiutopismus – verstanden im Sinne einer negativ-dialektischen Denkbewegung – zentral für die materialistische Gesellschaftskritik ist. Dies sollte allerdings nicht als Verzicht auf Zukunftsdenken missverstanden werden. Vielmehr eröffnet es die Möglichkeit, gesellschaftliche Veränderung in ihrer Offenheit zu begreifen. Antiutopismus bedeutet hier also keine resignative Haltung, sondern verweist auf die methodische Notwendigkeit, gesellschaftliche Emanzipation negativ-dialektisch, also als Prozess, zu denken.
Im Zentrum steht dabei Marx‘ Begriff der negativ-dialektischen Vermittlung, mit dem sich die methodische Struktur seines kritischen Projekts erfassen lässt. Ich möchte zeigen, dass die Traditionslinie, die später in der Kritischen Theorie Gestalt annimmt, als undogmatischer Marxismus verstanden werden kann, der an diese Interpretation anschließt. „Hoffnung“ fungiert in diesem Zusammenhang als negativ-dialektischer Gegenbegriff zu jener „falschen Positivität“ (Adorno) von Utopie, in der Zukunft spekulativ und statisch fixiert erscheint. Hoffnung dagegen ist keine passive Erwartung, sondern ein Antrieb emanzipatorischer Praxis, die betont, dass gesellschaftliche Verhältnisse historisch entstanden sind – und damit veränderbar bleiben.
Dieser Ansatz eröffnet nicht zuletzt Perspektiven für die Analyse antidemokratischer Regressionen, die jenseits vereinfachender Fortschritts- oder Verfallsvorstellungen theoretisch erfasst und im Zusammenhang kapitalistischer Vergesellschaftung verstanden werden können.