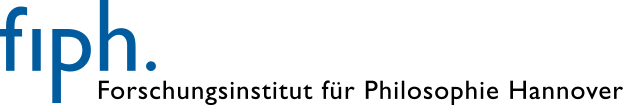Fellow von Oktober 2025 bis Juli 2026
Zur Person
Tobias Heinze hat Politische Theorie und Soziologie in Frankfurt, Darmstadt, Münster und New York studiert. Er promoviert im Fach Philosophie an der Johann Wolfang Goethe-Universität Frankfurt am Main und ist Doktorand am Frankfurter Institut für Sozialforschung. In seiner sozialphilosophischen Dissertation blickt er darauf, an welche Grenzen die Gesellschaftskritik der Kritischen Theorie angesichts der gegenwärtigen ökologischen und klimatischen Veränderungen stößt. In Verbindung damit untersucht er die Philosophie Schellings auf Anhaltpunkte für eine Sozialphilosophie, die angesichts der ökologischen Krise eine Verbindung von Gesellschaftskritik und Naturphilosophie leisten kann.
Die Forschungsschwerpunkte von Tobias Heinze liegen in der Sozialphilosophie, der Kritischen Theorie, der Naturphilosophie, der psychoanalytischen Sozialpsychologie sowie der Politischen Theorie. Vor Promotionsbeginn hat er zu dem Kasseler Sozialphilosophen Ulrich Sonnemann und seinem Entwurf einer Negativen Anthropologie sowie zur Politischen Theorie der radikalen Demokratietheorie, des Republikanismus und des internationalen Rechts gearbeitet. 2026 erscheint ein von ihm mitherausgegebener Sammelband zur Subjekttheorie der Kritischen Theorie und der ökologischen Krise. In dem Buch „Subjekte der ökologischen Verwüstung. Kritische Theorie der Klimakatastrophe“ wird ausgelotet, inwiefern die Verbindung von neomarxistischer Gesellschaftstheorie und psychoanalytischer Subjekttheorie helfen kann, die unverminderte Destruktion ökologischer Zusammenhänge zu verstehen und zu kritisieren.
https://www.ifs.uni-frankfurt.de/personendetails/tobias-heinze.html
https://uni-frankfurt.academia.edu/TobiasHeinze
Das Projekt am FIPH
Veränderliche Natur. Kritische Theorie der Natur nach Schelling, Horkheimer und Adorno
Die Kritische Theorie der Frankfurter Schule ist eine Krisentheorie mit einer langen Geschichte der kritischen Intervention angesichts gesellschaftlich erzeugten, vermeidbaren Leids. Um die gegenwärtige Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse zu verhandeln, werden allerdings oft Theoriesprachen herangezogen, die ein im Vergleich zur Kritischen Theorie nur gering ausgeprägtes gesellschaftstheoretisches und ideologiekritisches Profil aufweisen. Das Projekt geht davon aus, dass dies auch daran liegt, dass der Naturbegriff der Kritischen Theorie die naturalen Aspekte der ökologischen Krise nicht hinreichend berücksichtigen kann. Neben einer Analyse der Naturbegriffe Max Horkheimers und Theodor W. Adornos wird in dem Projekt als möglicher Ansatzpunkt für eine Rekalibrierung dieser Begriffe die Philosophie F.W.J. Schellings diskutiert.
Um zu ermessen, wo und inwiefern die Kritische Theorie für ihren Naturbegriff neue Impulse beziehen kann und muss, wird in einem ersten Schritt diskutiert, welche Aspekte der Gegenwart ökologischer Destruktion gegenüber dem Entstehungskontext der frühen Kritischen Theorie neu bzw. anders sind. Es wird vorgeschlagen, mit dem Begriff veränderlicher Natur hierbei vor allem darauf zu blicken, dass die in der Kritischen Theorie meist mit dem Begriff der äußeren Natur bezeichnete Umwelt in der ökologischen Krise nicht nur als dynamisch, sondern als gerichtet veränderlich zu beschreiben ist. In mal graduellen, mal katastrophischen Transformationen werden die Lebensbedingungen der menschlichen Lebensform angesichts der Zerstörung ökologischer Zusammenhänge zusehends unwirtlich. Das Projekt geht davon aus, dass Natur in den Werken Adornos und Horkheimers zwar teils als dynamisch bzw. lebendig definiert wird, diese Naturbegriffe jedoch angesichts des in ihren Werken nicht verhandelten Problems der ökologischen Krise unterbestimmt bleiben.
Zur Prüfung dieser Annahme werden in einem zweiten Schritt die Überlegungen beider Philosophen zu Naturgeschichte, Naturbeherrschung und Naturästhetik diskutiert. Ausgehend von den sich hierbei zeigenden Leerstellen wird in einem dritten Schritt die Philosophie Schellings daraufhin analysiert, inwiefern sie der Kritischen Theorie helfen kann, ihren Naturbegriff zeitgemäß zu bestimmen. Abschließend wird gezeigt, wie das so formulierte Theorieangebot erlaubt, an dem gesellschaftskritischen Profil der Kritischen Theorie festzuhalten ohne hierbei die naturalen Aspekte der ökologischen Krise aus dem Blick zu verlieren.